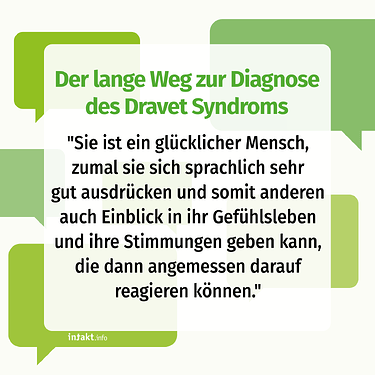Der lange Weg zur Diagnose des Dravet Syndroms
Unsere Tochter F. wurde an einem Sonntag im Herbst 1991 geboren. Als gesundes Kind mit kräftiger Stimme, zarter Statur und einem dichten schwarzen Haarschopf kam sie zur Welt.
Um die Weihnachtszeit des gleichen Jahres konnte ich ein ruckartiges Anheben der Arme und Beine sehen.
Es geschah nur ein Mal bzw. konnte von mir nur einmal beobachtet werden. Es beunruhigte mich dennoch, denn vor ihrer Geburt arbeitete ich in einer Frühförderstelle und sah hin und wieder epileptische Anfälle bei jungen Kindern.
Danach verlief ihre Entwicklung gut und unauffällig (augenscheinlich) bis zu ihrem zehnten Lebensmonat.
Wir wagten zum ersten Mal mit ihr eine Urlaubsreise und hielten uns in Ungarn auf.
In einer Schaukel gut gesichert, wurde sie steif und begann am gesamten Körper an zu zucken.
In der Klinik erhielten wir kaum Aussagen hinsichtlich der gravierenden Auffälligkeiten, die über viele Stunden anhielten. Wir erinnern uns an etwas sechs Stunden. Dies war ein Status Epilepticus, der lebensbedrohlich war, was wir damals noch nicht wussten.
Nach abgebrochener Reise wurde sie in Deutschland eingehend von einem Kinderarzt untersucht und wir bekamen ein Notfallmedikament (Diazepam), was wir im Wiederholungsfall geben sollten. Man sprach von einem epileptischen Anfall und der Möglichkeit einer Wiederholung.
Nach sechs Wochen wiederholte sich das Ereignis nochmals: beim Aufwachen sah ich dass mein Kind im Bettchen neben mir wiederum krampfte. Das Notfallmedikament half nicht, so dass in der nahen Kinderklinik eine Narkose eingeleitet werden musste, um diesen Anfall zu stoppen.
Im Rahmen des Aufenthaltes in der Klinik wurde zum ersten Mal die Diagnose „Frühkindliche Grand-mal-Epilepsie“ gestellt.
Nun erfolgte eine Einstellung mit Phenobarbital, dann mit Valproatsäure, was nicht zum Erfolg führte.
Mittlerweile hatte sie nicht nur die Anfälle mit tonisch-klonischer Phase, Bewusstseinsverlust und langer Nachschlafphase, sondern auch Anfälle, die sich dadurch auszeichneten, dass sie schlaff wurde und bis zu 20 Minuten nicht mehr ansprechbar war.
Nach mehreren Monaten entschlossen wir uns das Epilepsiezentrum Kehl-Kork aufzusuchen, um weitere diagnostische Schritte zu gehen. Die Anfälle kamen ungehindert, mal zwei bis drei Mal die Woche, dann wieder ein bis zwei Mal im Monat.
In den acht Monaten an der Fachklinik wurden verschiedene Medikamente eingesetzt, Kombinationen versucht und wir konnten unser Kind unter den Medikamenten teilweise stark verändert erleben.
Nach dieser Zeit und den folgenden Jahren galt F. als therapieresistent, d.h. trotz der Medikation und den Medikamentenkombinationen wurde sie nicht Anfall frei.
Insgesamt kamen über zehn verschiedene Medikamente zum Einsatz und auch die Diagnostik hinsichtlich Epilepsie-Chirurgie verlief negativ, da sie Anfälle hatte, die wohl tw. fokal anmuteten (von einem Punkt im Gehirn auszugehen schienen), jedoch eher komplex fokal waren (von mehreren Bereich gleichzeitig ausgehend) oder generalisierten (d.h. das ganze Gehirn betreffend).
Im Verlauf ihrer Entwicklung wurde nach dem vierten Lebensjahr deutlich dass sich ihre Entwicklung verlangsamte, eine lern- bzw. geistige Behinderung immer deutlicher wurde. Zudem zeigten sich Verhaltensauffälligkeiten, die nicht zu übersehen waren. Ihre Gefühle konnte sie kaum kontrollieren: so war sie schnell wütend, sehr traurig, überaus freudig und im Kontakt mit anderen Kindern war es immer erforderlich nah bei ihr zu sein, weil sie auch da überschießend reagierte.
Sie wurde nach dem Besuch eines integrativen Kindergartens in eine Schule zur Förderung der motorischen Entwicklung eingeschult, da Menschen mit Epilepsien zum Personenkreis gehörten, die in eine solche Schule aufgenommen werden konnten.
Erst im Alter von 17 Jahren erhielt F. eine endgültige Diagnose: Variante eines Dravet-
Syndroms mit SCN1A-Punktmutation mit seitwechselnd lateralisierten fokalen Anfällen, z.T. mit unbestimmter, z.T. visueller Aura, mit sekundärer Generalisation G40.8G, leichte Intelligenzminderung mit Verhaltensproblemen.
Durch den behandelnden Kinderarzt und Epileptologen, der F. bis zum 18. Lebensjahr behandelte und uns begleitete, kamen wir an die Universitätskinderklinik in Giessen, wo eine
molekulargenetische Untersuchung aus einer Speichelprobe heraus und eine weitere ausführliche Anamnese stattfanden.
Nach wenigen Wochen erhielten wir die o.g. Ergebnisse, die endlich Klar- und Gewissheit brachten.
Über alle die Jahre mussten wir erleben, wie die Entwicklung unseres Kindes stagnierte, die
schulischen aber auch sozialen Probleme zunahmen, Verhaltensprobleme hinzukamen und sich eine Epilepsie entwickelte, die schwer behandelbar war und blieb.
Begleitung und überwiegend Unterstützung erhielten wir von den ihr und uns zugewandten Ärzten im pädiatrischen Bereich aber auch im Bereich der Fachkliniken (Epilepsiezentrum Kehl-Kork z.B.).
Mit allen anderen Betreuern unseres Kindes mussten wir oft Gespräche führen, uns für sie
einsetzen, um Verständnis werben, unsere Mitarbeit anbieten, um es kurz zu sagen uns für unser Kind über alle Maßen engagieren.
Heute ist F. eine junge Frau von 34 Jahren. Sie trägt einen Sturzhelm, der sie vor großen
Verletzungen am Kopf- und Gesichtsbereich schützt. Diesen Helm akzeptiert sie, weil sie immer wieder erlebte, dass sie von den Anfällen zumindest blaue Flecken bekommt und auch schon mal ein Zahn dran glauben musste.
Sie lebt nun seit 2019 in einer Wohngruppe für Menschen mit erhöhtem Betreuungsbedarf, hat dort Freunde gefunden und ist dennoch liebend gerne mit uns unterwegs. Sie besucht uns regelmäßig alle drei Wochen zuhause (wir holen sie ab) und fährt mit uns gerne in den Urlaub, besucht mit uns Musicals und schaut sich Filme im Kino an.
Sie ist ein glücklicher Mensch, zumal sie sich sprachlich sehr gut ausdrücken und somit anderen auch Einblick in ihr Gefühlsleben und ihre Stimmungen geben kann, die dann angemessen darauf reagieren können.
Auch hier im Bereich der Wohneinrichtung und in der Tagesförderstätte engagieren wir uns als Eltern. Wir suchen das regelmäßige Gespräch mit Wohngruppe und Tagesstätte und engagieren uns im Angehörigen-und Betreuerbeirat der Einrichtung. Wir versuchen so für unser „Kind“ weiterhin hilfreich und unterstützend zu agieren, weil sie es für sich selbst nicht in ausreichendem Maße tun kann.
Autorin: Gabi Rauch-Zürn (November 2025)