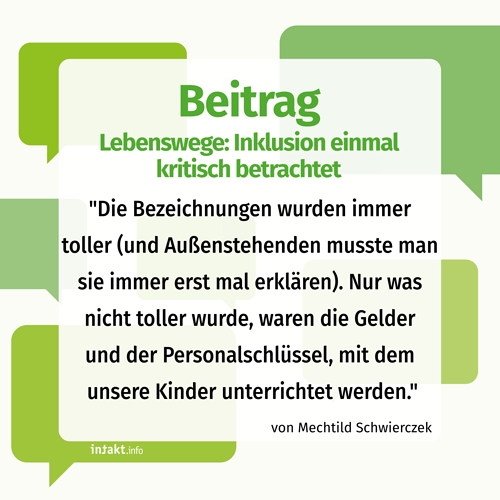Liebe Eltern, liebe Interessierte,
der heutige Gastbeitrag ist ursprünglich entstanden aus einem Vortrag für eine geplante Veranstaltung zum Thema Inklusion. Die Veranstaltung konnte coronabedingt nicht stattfinden. Umso schöner ist es, dass unsere Autorin ihren Lebenslinienvortrag in einen Beitrag verpackt hat und wir diesen heute mit euch teilen können.
Die Gastbeiträge sollen wie unsere Interviews Mutmacher sein und Lebenswege aufzeigen.
Durch ihre Erfahrung und ihre ganz individuellen Entscheidungen sind Eltern nicht nur Helfer und Ratgeber in herausfordernden Situationen, sondern auch Mutmacher dafür den eigenen Weg zu finden.
Ganz nach unserem Motto „Eltern als Experten in eigener Sache“.
Lebenswege: Inklusion einmal kritisch betrachtet
Die endgültige Diagnose „Schwere geistige Behinderung“ unseres ersten Sohnes kam schleichend, so mit der Zeit, aber trotzdem war sie dann schockierend. Der Psychologe, der unseren Sohn getestet hatte, stellte mir die entscheidende Frage: „Wovor haben Sie jetzt Angst?“.
Ja, wovor hat man Angst, wenn es darum geht, ein behindertes Kind zu haben oder zu bekommen?
Mir persönlich war vollkommen klar: Es ging nicht darum, den süßen Kleinen nicht mehr lieben zu können oder Angst vor den Operationen, die auf uns zukommen würden, zu haben. Nein. Ich hatte Angst davor, nicht mehr dazu zu gehören mit meiner Familie, ausgegrenzt zu werden.
Glücklicherweise hatte sich damals (vor mehr als 35 Jahren) der Verein Integrativer Kindergarten hier in Würzburg ganz neu gegründet. Da wollte ich mich engagieren, da sah ich eine Möglichkeit, nicht isoliert zu werden. Und die Kindergartenzeit verlief dann im Großen und Ganzen auch sehr schön für uns. Wir lernten andere Eltern kennen von behinderten und nicht-behinderten Kindern. Aber mit der Zeit merkte ich schon: Während der eigentlichen Kindergartenzeit war unser Sohn in der Gemeinschaft integriert, aber darüber hinaus lief nichts. Nur 1x wurde er während der 3 Jahre zu einer privaten Geburtstagsfeier eines nicht-behinderten Mädchens eingeladen! Und im Kindergartenalltag hörte ich ab und zu schon das Gemurmel, dies oder jenes könne man halt nicht machen wegen unseres Sohnes…
Nach der Kindergartenzeit kam er in die Schule der Lebenshilfe. Unvergesslich der erste Elternabend, an dem uns die Lehrkraft aufforderte, etwas Positives, Schönes über unser Kind zu erzählen. Ich war gerührt: Da fragt jemand mal danach, was unser Sohn kann und macht, warum wir ihn lieben! Und nicht danach, was er alles NICHT kann.
Je länger die Schulzeit dauerte, umso deutlicher wurde der Entwicklungsabstand zu seinen gleichaltrigen Mitschülerinnen und Mitschülern. Er war immer der Schwächste in der Klasse, was aber je nach Qualität der Lehrkräfte mal mehr, mal weniger „schlimm“ war. Denn ihm wurde stets viel geholfen, die Mitschüler zu sozialem Miteinander aufgefordert. Die zunehmend schlechter werdende Personalsituation brachte es allerdings mit sich, dass für die schwächsten Schüler immer weniger Zeit für Förderung blieb. Wichtig war ja, dass die anderen der Klasse wenigstens ein bisschen Lesen und Schreiben lernten!
Die Schulzeit ging vorüber und er kam in die Förderstätte einer sogenannten Komplexeinrichtung. Für einen Arbeitsplatz in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung ist er zu schwach, was für uns der nächste Dämpfer war. Aber es stellte sich als Glücksfall heraus: Seine Tagesstrukturierung in dieser kleinen Gruppe ist für ihn viel abwechslungsreicher als die Arbeit in der Werkstatt. Es kann hier viel besser auf seine Neigungen und Interessen eingegangen werden. Wir Eltern merkten, dass er zunehmend erwachsener und selbstbewusster wurde.
Dabei muss ich gestehen, dass solche „Komplexeinrichtungen“ für mich früher immer ein „Horror“ waren: Das klang so nach Ghetto und Abschieben. Und nun war also unser Sohn dort gelandet! –
Vor vielen Jahren unterzeichnete Deutschland die UN- Behindertenrechtskonvention, die Deutschland dahingehend interpretiert, dass möglichst alle „Sonder“-Einrichtungen, wie spezielle Kindergärten, Schulen, Werkstätten und solche „Komplexeinrichtungen“ möglichst abgeschafft werden sollen. Inklusion wurde das neue Schlagwort, an dem niemand vorbeikommt!
Inklusion!?
Als ehemalige Elternbeiratsvorsitzende habe ich 3 Namensänderungen der Förderschule (und selbst SO sagt man ja heute nicht mehr!) unseres Sohnes miterlebt. Die Bezeichnungen wurden immer toller (und Außenstehenden musste man sie immer erst mal erklären). Nur was nicht toller wurde, waren die Gelder und der Personalschlüssel, mit dem unsere Kinder unterrichtet werden.
Auch soll man das Wort „Behinderung“ am besten gar nicht mehr benutzen, verbunden wohl mit der Hoffnung, dass damit Ausgrenzung und Diskriminierung verringert würden…
Ist das aber realistisch?
Ich erlebe eine andere Realität:
-
Eine immer spezifiziertere, individualistischere Gesellschaft, die sich immer mehr zu Extremen hin entwickelt; in der sich schon viele nicht-behinderte Menschen im Alltag ausgeschlossen fühlen oder an Grenzen stoßen, psychologische Hilfe in Anspruch nehmen müssen
-
eine Leistungsgesellschaft, in der der Begriff „Leistung“ nicht relativ, sondern absolut gesehen wird (denn für meinen Sohn ist es z.B. eine enorme Leistung, dass er es trotz seiner Wahrnehmungsstörungen geschafft hat, in einer Wohngruppe zu leben mit 7 zunächst völlig fremden Menschen und 6 in Schicht arbeitenden Betreuerinnen und Betreuern),
-
eine Medizintechnik, die immer verfeinerter auf der Jagd nach Gendefekten ist, um sie dann ausschließen zu können, sprich: das ungeborene Kind abtreiben zu können. Wo bleibt die Empörung DARÜBER? Für Inklusion sind fast alle, aber wer protestiert ernsthaft dagegen, dass Menschen mit möglicher Behinderung das Lebensrecht abgesprochen wird?
-
Eine aufgeblähte Life-Style-Industrie, die mit der Selbstoptimierung des menschlichen Körpers und des eigenen Lebens Millionen verdient…
Und das alles soll sich dadurch ändern, dass ich bestimmt Wörter auf die „no-go-Liste“ setze?
Ist es in Wirklichkeit nicht so, dass die Mehrzahl der Eltern nicht gerade davon begeistert ist, wenn in der Klasse ihres Kindes ein oder sogar zwei Kinder mit einer Behinderung sitzen?
Der „Run“ zu den Privatschulen, wo eine selbst ernannte Elite lieber unter sich bleiben will, nimmt zu…
Was steckt wirklich hinter der Frage: Hast du vor der Geburt gewusst, dass dein Sohn behindert ist?
Was bedeutet die inzwischen wieder gestellte Frage, was behinderte Menschen dem Staat und somit der Gesellschaft kosten?
Was meinen die so locker hingeworfenen Sätze: „Na, die ist ja auch gestraft mit ihrem Kind!“ oder: „Hauptsache gesund!“
Und mal ehrlich: Steckt nicht ganz tief in uns drin auch immer die Frage: Wer hat Schuld, dass SO ein Kind geboren wurde?
Das alles soll sich dadurch ändern, dass „Sondereinrichtungen“ abgeschafft und das Wort „Behinderung“ verboten wird?
Und machen wir einmal einen Perspektivwechsel:
Ist es wirklich sinnvoll oder pädagogisch wertvoller, wenn ein Kind mit einer Behinderung in einer Regelschule immer spürt, dass es etwas „Besonderes“ ist? Extra Schulbegleitungen, extra Nebenraum und einmal oder zweimal pro Woche kommt jemand vom Mobilen Sonderpädagogischen Dienst vorbei?
Ich las einmal ein Buch von einer blinden Frau, deren Eltern sie in den 1980er Jahren aus gut gemeinten Gründen in die ortsnahe Grundschule schickten. Mit der Zeit und als es auf die Pubertät zuging, wollte die junge Frau aber von sich aus lieber in ein Zentrum für sehbehinderte Menschen wechseln. Sie spürte den steigenden Druck, nun auch so sein zu müssen wie alle anderen. Normalisierungsdruck. In der Fördereinrichtung musste sie dann erst einmal damit klarkommen, dass sie nichts Besonderes mehr war, eine unter Vielen, dass ihr nicht ständig Hilfe angeboten wurde. Das hat sie selbstbewusster und selbständiger gemacht. –
Ein Stück wieder zurück: Nachdem unser zweiter Sohn geboren war, waren wir dann quasi auch eine etwas „normalere“ Familie bei uns im Dorf. Wir fuhren mit unseren Jungs im Urlaub in verschiedene Centerparcs, weil es da immer ein Hallen- und Spaßbad gibt, was beide liebten und die Schlechtwettertage waren gerettet. Man traf dort durchaus auch andere Familien mit Kindern, die z.B. das Down-Syndrom haben. Trotzdem: Man fällt immer auf mit seinem behinderten Kind.
Eine Freundin von mir, die uns schon zweimal in den Sommerferien nach Südfrankreich und Italien begleitet hat, sagte einmal: „Ich muss mich erst wieder daran gewöhnen, dass alle gucken!“ Ehrlichkeit unter Freundinnen ist wichtig!
Und dann gab es für uns auch Zeiten, in denen wir mal „unter unseres-gleichen“ sein wollten. Zum Glück bietet der Familienbund Würzburg seit über 25 Jahren Ferienfreizeiten für Familien mit behinderten Angehörigen an. DAS tat gut! Man musste sich nicht ständig erklären oder rechtfertigen, warum sich das Kind z.B. am Esstisch oder sonst so verhält. Da durfte man auch mal davon erzählen, wie uns unsere behinderten Kinder nerven und über sie schimpfen und Witze machen. In der „normalen“ Gesellschaft hat man meist das Gefühl, das kommt nicht so toll rüber. Entweder man erntet Betroffenheit oder Mitleid.
Ich denke, es braucht vor allem Ehrlichkeit. Keine Dogmen, sondern Offenheit und Ehrlichkeit in der Gesellschaft, aber auch Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Welcher Erwachsene ist mit einem Menschen mit geistiger Behinderung eng befreundet? Wir suchen uns alle unsere Freunde doch eher danach aus, ob auch die „Wellenlänge“ stimmt. Kindergarten, Schule und Arbeitsstelle sind doch nur ein Aspekt des Lebens.
Wichtig wäre, genau hinzuschauen: Was braucht der einzelne Mensch wirklich? Was tut ihm oder ihr gut, wo braucht es vielleicht auch einen geschützteren Rahmen, um nicht überfordert zu werden? Wo gibt es auch Grenzen, die weh tun?
Für Eltern behinderter Kinder bleibt, so habe ich das Gefühl, auch nach 35 Jahren, immer auch eine Wunde, die zwar mit der Zeit vernarbt, aber doch da ist. Der Gedanke: Wie würde sich unser nicht-sprechender Sohn anhören, wenn er reden könnte? Wie wäre unser Leben verlaufen, wenn er nicht behindert wäre, solche Überlegungen ploppen bei mir an jedem seiner Geburtstage auf. Aber ich kann auch sehen und mich darüber freuen, was ich alles durch seine Behinderung gelernt habe, wie viele supergute Menschen ich kennengelernt habe, weil er eben diese Behinderung hat. Und ganz sicher wäre auch sein jüngerer Bruder ein anderer Mensch geworden, wenn er nicht so einen großen Bruder gehabt hätte.
Ich kann nicht die ganze Welt verändern, aber in meinem persönlichen Umfeld kann ich, oft unbewusst, ab und zu Denkanstöße und kleine Veränderungen bewirken, die mich freuen und mir immer wieder Mut machen. So sagte mir eine Bekannte vor Jahren einmal, dass sie bewusst auf eine Pränataluntersuchung verzichtet habe, weil sie uns kenne und an unserer Familie gesehen habe, dass man durchaus mit einem behinderten Kind Spaß am Leben haben und eine zufriedene Familie sein kann.
Und wunderbar finde ich es auch, wenn ich unseren Sohn einfach irgendwohin mitnehmen kann, die Menschen ihm freundlich begegnen und zu mir sagen: „Das passt schon!“ Letztens sprach mich eine Frau nach dem Gottesdienst an: „Ich freu mich immer so, wenn ich Sie mit Ihrem Sohn in der Kirche sehe. Er strahlt immer so und die Atmosphäre ist gleich eine andere.“
Mehr braucht es manchmal gar nicht.
Verfasserin: Mechtild Schwierczek (März 2023)