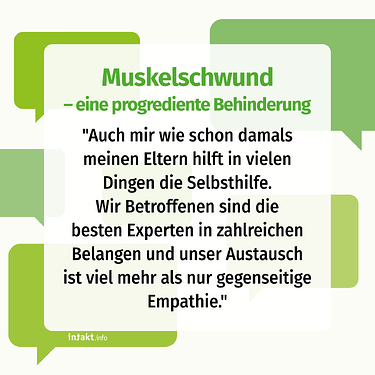Muskelschwund – eine progrediente Behinderung
Darf ich mich vorstellen? Ich bin Julian, ich bin Sportler und Trainer, ich bin kommunaler Behindertenbeauftragter, ich bin Diplom-Psychologe, ich bin vielseitig interessiert – und ich habe eine Spinale Muskelatrophie.
Es ist nicht immer einfach zu entscheiden, ob die Behinderung bei einer Vorstellung genannt wird. Denn es gibt so viele Bereiche meines Lebens und so viele Facetten meiner Persönlichkeit, die mich ausmachen und mit denen ich mich identifiziere. Aber die Behinderung ist definitiv ein Teil meiner Identität. Wenn man sie ignoriert, ignoriert man einen Teil meines Selbsts, einen Teil meiner Person. Sie prägt mich langfristig und sie beeinflusst in nahezu jeder Minute meinen Alltag, sie gehört zu mir und das ist gut so.
Sicherlich fällt eine Aussage wie diese einigen Betroffenen schwer. Denn es besteht vor allem im Umgang mit Anderen ein Unterschied darin, ob die Behinderung wie bei mir deutlich sichtbar ist oder nicht. Und es besteht ein Unterschied darin, ob man wie bei mir das Leben nur mit Behinderung kennt oder ob man lernen muss – eventuell sogar von heute auf morgen –, mit diesem Leben zurecht zu kommen. Letztere Situation müssen Eltern durchstehen, wenn sie mit der Behinderung ihres Kindes konfrontiert werden. Da kann ein einfacher Begriff, eine Diagnose, das komplette Leben auf den Kopf stellen.
Bildquelle: Kathrin Königl
Fragen über Fragen
Ich kann nicht nachempfinden und nachvollziehen, wie sich meine Eltern gefühlt haben, als sie die beiden Worte „Spinale Muskelatrophie“ aus dem Munde des Arztes hörten, der mich im Alter von 15 Monaten kurz zuvor mit einer Muskelbiopsie – der in den 80ern einzigen Möglichkeit einer Diagnose – regelrecht gequält hatte. Da waren die sich überbordenden Emotionen, der Schock. Und da waren die Sorgen und Fragen, die Karussell fuhren:
Ist die Behinderung heilbar? Nein. Was bedeutet die Behinderung? Die Muskeln bekommen zu wenig Impulse und verkümmern. Ist das wirklich nicht heilbar? Nein. Muss Julian leiden? Was ist Leiden? Was bedeutet Progredienz? Der Muskelabbau schreitet fort. Wie äußert sich das? Julian wird nie laufen können, wird zunehmend Hilfe und Pflege benötigen. Wird er früh sterben? Ja, sehr sicher. Ist das wirklich nicht heilbar? Nein. Was können wir dann tun? Regelmäßige Physiotherapie kann den Abbau verlangsamen. Aber nicht aufhalten? Nein. Wie kam es zu der Behinderung? Es ist ein Genfehler, der sich auswirkt, wenn beide Eltern ein bestimmtes, aber sehr seltenes Merkmal in ihrem Genom haben. Wird unser zweiter Sohn ebenfalls behindert sein? Zu 25 % ja. Was sagen unsere Verwandten und Freunde jetzt? Wollte Gott das? Wie sollen wir das schaffen? Wie verläuft unser Leben jetzt?
Fragen über Fragen. Ärzte waren dabei keine große Hilfe, die Diagnose den meisten nicht einmal bekannt. Die Physiotherapie war beanspruchend für Alle und zeigte keinen großen Effekt. Und bei den wirklich wichtigen Fragen, denen des alltäglichen Lebens, muss man sich sowieso breit gefächerte Informationen einholen, sich seinen eigenen Wissensschatz aufbauen und seinen eigenen Weg finden.
Bildquelle: Privat
Umstellung des Alltags
Diesen Weg haben meine Eltern gefunden. Dass mein Bruder wenige Monate später die gleiche Diagnose erhielt, war dabei weniger Hemmnis als viel mehr Antrieb. Schnell zogen sie in eine ebenerdige Wohnung, schnell wurden Stühle mit Rollen versehen, das Bobbycar verschenkt und stattdessen passende Spielsachen wie Lego gekauft. Sie kümmerten sich liebevoll um mich, förderten meine Entwicklung nahezu in Perfektion, sahen nicht meine Defizite im Vordergrund, sondern meine Fähigkeiten und erfreuten sich an meiner ununterbrochenen Lebensfreude und an meiner intellektuellen Entwicklung. Schon im Kindergarten konnte ich lesen und durfte dank meiner Eltern den Sport Elektrorollstuhl-Hockey (heute Powerchair Hockey) kennen und lieben lernen.
Bildquelle: privat
Bildquelle: privat
Wenn sie heute über wertvolle Unterstützungen in dieser Phase sprechen, nennen sie die lokale Frühförderstelle, die nicht nur mich in meiner Entwicklung förderte, sondern auch meine Eltern in einer wohltuenden Weise begleitete. Sie nennen außerdem die starke nachbarschaftliche und verwandtschaftliche Unterstützung, die mit Ratschlägen und Tatkraft zur Seite stand und meinen Eltern dadurch auch Aufgaben abnehmen konnte. Und drittens nennen sie die Selbsthilfe, die es möglich machte, von Erfahrungen Anderer zu profitieren und sich gegenseitig in einer empathischen und äußerst kompetenten Weise zu beraten. So gelang es meinen Eltern letztlich sehr gut, die Behinderung ihres Kindes zu verstehen, einzuordnen und anzunehmen.
Die Perspektive des direkt Betroffenen
Wenn ich mir nun, da ich mittlerweile schon deutlich älter bin als meine Eltern es zum Zeitpunkt der Diagnose waren – und übrigens auch deutlich älter als die Ärzte es mir vorausgesagt hatten –, die Fragen durchdenke, die sich meine Eltern damals gestellt hatten, betrachte ich viele dieser Fragen in einer recht rationalen, vielleicht sogar nüchternen Art:
Es ist nicht schlimm, dass die Behinderung nicht heilbar ist. Denn sie ist kein Leiden für mich. Ich kenne das Leben nur so, es fühlt sich für mich alles normal an. Und mit meinen „Problemen“ kann ich umgehen. Ich habe gelernt, dass ich viele Kraftverluste kompensieren kann, sei es durch Hilfsmittel oder einfach durch Kreativität. Und wenn es doch einmal zu Verlusten von gesamten Fähigkeiten kommt, wie zum Beispiel mit der Hand schreiben, alleine essen, etc., dann ist das wohl traurig, aber es gibt andere Fähigkeiten, die ich eben noch kann.
Nur in sehr seltenen und kurzen Phasen empfinde ich ein Leid über meine Behinderung, trauere oder hadere ich. Beispielsweise erinnere ich mich auch noch an das Erlebnis, in dem ich bewusst eine Art „Diagnose“ mit den zugehörigen Auswirkungen gehört habe. Ich war mit 10 Jahren aufgrund einer großen Rückenoperation im Krankenhaus und von daher schon in einer gedrückten Stimmung. Aus dem Zimmer heraus hörte ich, wie mein Vater mit einer anderen Mutter über die Progredienz meiner Behinderung sprach. In dieser Situation realisierte ich erst, dass ich schwächer wurde. Vorher hatte sich das für mich nicht in mein Bewusstsein gespielt.
Solche Momente gibt es natürlich auch heute noch, aber wie schon damals werfen sie mich nicht aus der Bahn. Ich frage mich nicht „Wie soll ich das nur schaffen?“, „Werde ich in meiner letzten Lebensphase leiden müssen?“ oder „Warum gerade ich?“. Die Fragen, die mich beschäftigen, sind eher praktischer Art und bilden meine Suche nach einem Erhalt meiner sehr hohen Lebensqualität und damit auch meiner Lebensfreude ab: Wie kann ich noch mehr Selbstbestimmung erreichen? Wie kann ich die Persönliche Assistenz weiter ausbauen, ohne Pflegequalität und familiäre Fürsorge einzubüßen? Wie kann ich meinen Kopf nachts lagern, um weniger Sauerstoffmangel zu haben? Wie kann ich meine Sexualität erfüllend erleben? Welches Buch kann ich schreiben oder was kann ich beruflich tun, um über meinen Tod hinaus zu wirken?
Anders, aber genauso schön
Auch mir wie schon damals meinen Eltern hilft in vielen Dingen die Selbsthilfe. Wir Betroffenen sind die besten Experten in zahlreichen Belangen und unser Austausch ist viel mehr als nur gegenseitige Empathie. Wir können uns Hilfsmittel empfehlen, Ratschläge erteilen oder auch nur Alltagstipps geben. Und gerade die Letzteren sind es, die das tägliche Leben deutlich erleichtern. Allzu oft erspare ich mir sogar teure Anschaffungen oder große medizinische Eingriffe, indem ich 1) auf meinen Körper achte, 2) mich für meine Behinderung und die damit zusammenhängenden Themen „interessiere“ und 3) kreative Lösungen für den Alltag finde.
Als Beispiel für solch eine kreative Lösung sei ein Häcksler genannt, mit dem ich zahlreiche meiner Speisen so stark zerkleinern kann, dass ich sie nicht mehr kauen muss, aber dass sie trotzdem noch lange kein Brei sind. Dadurch ist es mir möglich, auf eine Magensonde zu verzichten, mich trotzdem ausreichend und vollwertig zu ernähren und dabei sogar noch den Genuss zu empfinden, den man beim Essen gerne hat.
So gelingt es meinen Eltern, meinem Bruder und mir, ein fröhliches und sehr erfüllendes Leben zu führen. Und als wollte er diesen langen Text in einen einzigen Satz zusammenfassen, hat mein Vater einmal zu einer jungen Mutter gesagt, was er schon nach wenigen Monaten erfahren hat und jetzt nach mittlerweile 40 Jahren noch genauso empfindet: „Das Leben mit einem Kind mit Behinderung verläuft sicher ganz anders, als man es sich vorher vorgestellt hatte. Aber es ist definitiv genauso schön.“
Verfasser: Julian Wendel (November 2025)